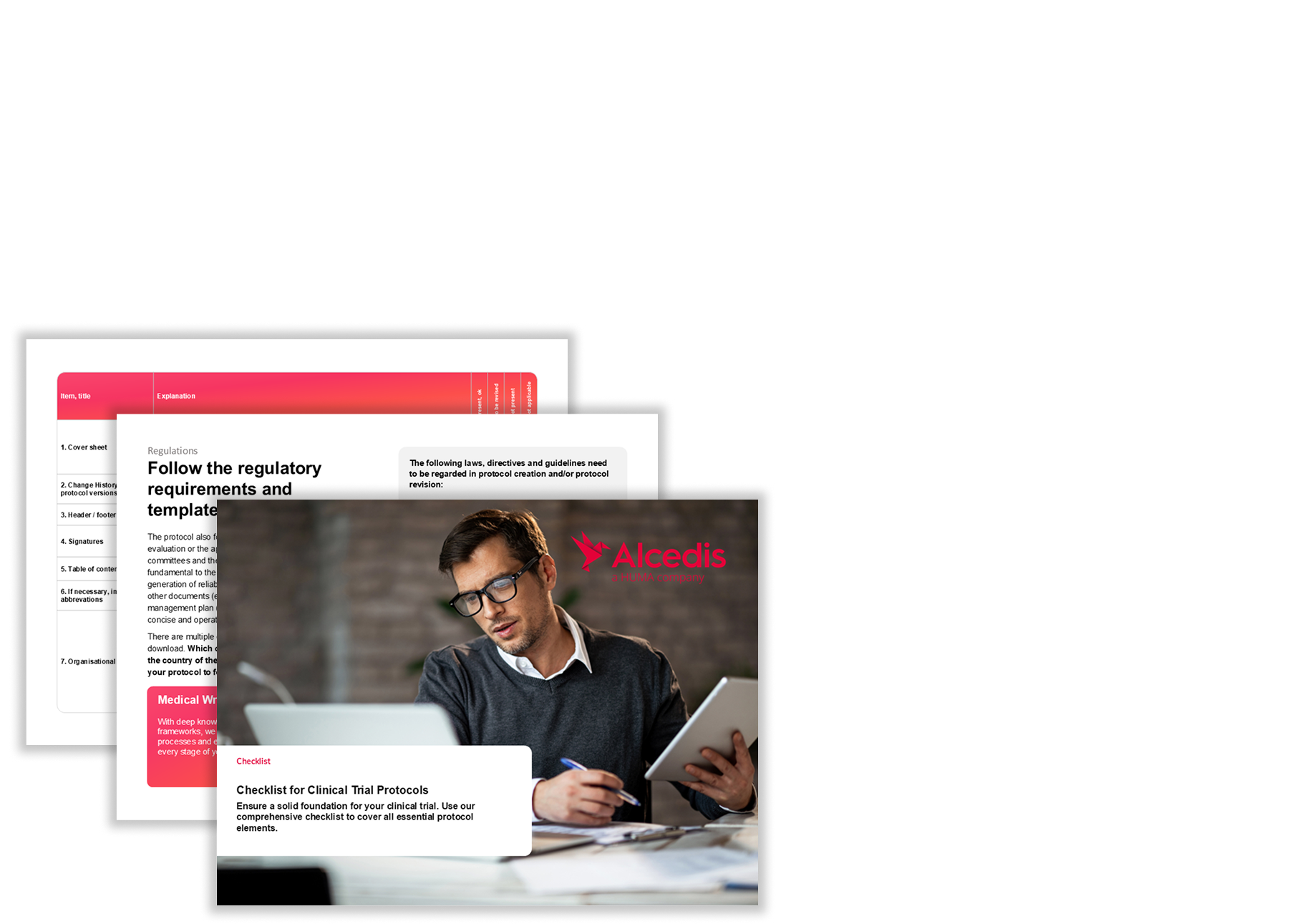Virtuelle Patienten und Avatare zur Optimierung klinischer Studien
Erstellt am: 08.06.2022
Digitale Technologien revolutionieren die medizinische Forschung. Ein vielversprechender Ansatz in diesem Bereich sind Avatare und virtuelle Patienten, die in klinischen Studien zunehmend an Bedeutung gewinnen. Doch wie genau funktionieren virtuelle Patienten? Wo werden sie eingesetzt? Welche Vorteile bieten sie für die Forschung?
Warum der virtuelle Patient klinische Studien verändert
Zeit ist ein entscheidender Faktor in der Entwicklung neuer Medikamente. Klinische Studien dauern oft viele Jahre, da jeder Schritt – von der Patientenrekrutierung bis zur abschließenden Datenauswertung – sorgfältig geplant und durchgeführt werden muss. Verzögerungen können sowohl für die Teilnehmer als auch für die medizinische Forschung schwerwiegende Folgen haben und einen hohen Verbrauch von Ressourcen bedeuten.
Digitale Innovationen wie der virtuelle Patient könnten dazu beitragen, diesen Prozess zu beschleunigen und gleichzeitig die Qualität der Ergebnisse zu verbessern. Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Big Data lassen sich virtuelle Patienten simulieren, die auf echten Patientendaten basieren. Dadurch wird die Durchführung klinischer Studien effizienter und gezielter.
Was ist ein virtueller Patient?
Bei einem virtuellen Patienten handelt es sich nicht um den digitalen Zwilling eines realen Patienten. Vielmehr handelt es sich um eine computergenerierte Simulation, die auf einer Vielzahl anonymisierter Patientendaten basiert. Dabei werden wichtige Faktoren wie Alter, Geschlecht, Krankheitsverlauf und genetische Merkmale berücksichtigt.
Dank dieser Technologie können Wissenschaftler realistische Modelle entwickeln, um Krankheitsverläufe vorherzusagen und die Wirkung neuer Therapien zu testen – ohne dass echte Studien-Teilnehmer in jeder Phase der Studie einbezogen werden müssen.
Neues Whitepaper
Wo wird ein virtueller Patient eingesetzt?
KI-Algorithmen erstellen aus den Daten realer Patienten virtuelle Patienten. Da diese keine echten Personen darstellen, müssen manche rechtlichen Abläufe weniger intensiv verfolgt werden, wie beispielsweise die Einwilligung in die Weitergabe von Daten. So können die Daten dieser Avatare unkomplizierter verwendet werden. Weiterhin können diese Informationen zwischen verschiedenen Organisationen, etwa Kliniken, die an einer gemeinsamen Studie arbeiten, ausgetauscht werden.
Der virtuelle Patient kommt in verschiedenen Bereichen der medizinischen Forschung zum Einsatz:
- Simulation von Langzeitwirkungen: Forscher können analysieren, wie sich eine Therapie über Jahrzehnte hinweg auswirken könnte, ohne so lange warten zu müssen.
- Optimierung von Studiendesigns: Vor der Rekrutierung realer Teilnehmer können Tests an virtuellen Patienten durchgeführt werden, um die Wirksamkeit und Sicherheit eines Medikaments besser abzuschätzen.
- Verbesserung der Datenqualität: Durch den Einsatz virtueller Patienten können Verzerrungen und medizinische Risiken reduziert werden, die in herkömmlichen klinischen Studien auftreten können.
Ein Beispiel für eine mögliche Anwendung ist die sogenannte „Was-wäre-wenn-Analyse“. Dabei kann simuliert werden, wie sich ein Medikament über einen langen Zeitraum auf den Körper auswirkt. Solche Analysen wären mit echten Patienten kaum durchführbar, da sie Jahrzehnte dauern würden.
Welche Vorteile bietet der virtuelle Patient?
Der Einsatz virtueller Patienten bringt zahlreiche Vorteile für klinische Studien mit sich:
- Schnellere Medikamentenzulassung: Da weniger reale Studien-Teilnehmer benötigt werden, kann der Rekrutierungsprozess erheblich verkürzt und die Zulassung von Medikamenten beschleunigt werden.
- Geringere Drop-out-Rate: Patienten, die eine klinische Studie frühzeitig abbrechen, können die Ergebnisse verfälschen. Virtuelle Patienten verhindern solche Verzerrungen.
- Bessere Vorhersagen: Die Daten virtueller Patienten ermöglichen präzisere Prognosen über die Wirkung und Verträglichkeit neuer Medikamente.
- Ethische Vorteile: Da virtuelle Patienten keine echten Menschen sind, können bestimmte ethische Hürden umgangen werden – beispielsweise im Bereich der Datennutzung.
Welche Herausforderungen der virtuelle Patient birgt
Zusätzlich müssen einige wichtige Dinge zur erfolgreichen Umsetzung bedacht werden:
- Datenqualität: Die Genauigkeit virtueller Patienten hängt von der Qualität und Menge der verfügbaren realen Patientendaten ab.
- Technische Komplexität: Die Entwicklung eines realistischen Modells erfordert umfangreiche Programmierung der künstlichen Intelligenz und medizinischer Expertise.
- Regulatorische Fragen: Die Nutzung virtueller Patienten in klinischen Studien muss weiterhin mit bestehenden medizinischen Standards und ethischen Richtlinien vereinbar sein.
Avatare als virtuelle Doppelgänger
Neben virtuellen Patienten gewinnen auch Avatare in der medizinischen Forschung an Bedeutung. Im Gegensatz zum virtuellen Patienten, der auf allgemeinen Daten basiert, stellt ein Avatar einen digitalen Zwilling eines individuellen Patienten dar.
Vor allem bei Schmerzpatienten oder Diabetikern kann der Avatar eingesetzt werden. Dieser wird in Echtzeit mithilfe von Sensoren am Körper mit den physiologischen Daten des realen Menschen gefüttert. Darauf kann eine künstliche Intelligenz Empfehlungen für die Behandlung, etwa die Dosierung eines Medikaments, generieren.
Ein weiteres Einsatzgebiet für Avatare ist die intelligente Wirkstoffabgabe durch therapeutische Pflaster. Während bei herkömmlichen Pflastern der Wirkstoff über Hautschichten selbst dann noch in den Körper gelangen kann, wenn das Pflaster längst entfernt ist, bieten Sensorsysteme individuellere und präzisere Lösungen. Die Technologie könnte zukünftig exakt berechnen, wie viel Wirkstoff ein Patient benötigt, und sicherstellen, dass nur diese Menge abgegeben wird. Dadurch lassen sich Nebenwirkungen minimieren und die Therapie individuell anpassen.
Die Zukunft der klinischen Forschung ist digital
Die Digitalisierung bietet enorme Chancen für medizinische Studien. Virtuelle Patienten und Avatare könnten in Zukunft eine Schlüsselrolle in der Entwicklung neuer Medikamente spielen. Durch den gezielten Einsatz dieser Technologien können klinische Studien effizienter, präziser und schneller durchgeführt werden – zum Vorteil aller Beteiligten.
Auch wenn es noch Herausforderungen zu bewältigen gibt, steht fest: Der virtuelle Patient wird mit seiner Kombination aus KI, Big Data und personalisierten Avataren die Planung und Durchführung klinischer Studien nachhaltig verändern und den Weg für eine neue Ära ebnen.